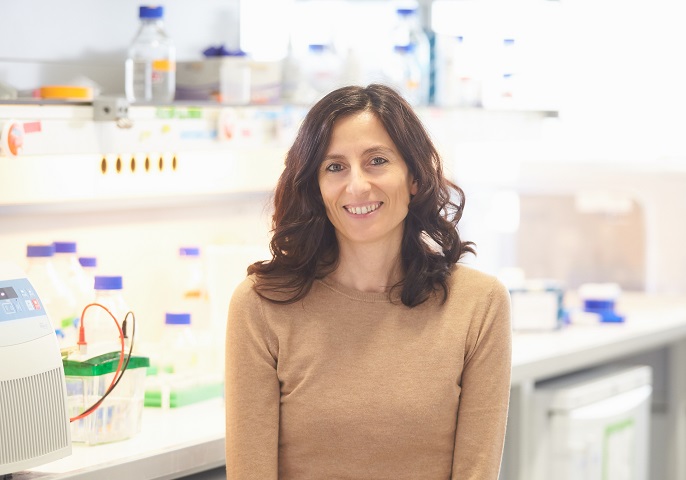Zellen möglichst exakt zu beeinflussen, ist das Ziel der Optogentik. Diese Kombination von optischen und genetischen Methoden hat seit den ersten Ansätzen vor gut zwanzig Jahren große Fortschritte gemacht. Die Wissenschaftlerin Barbara Di Ventura möchte diese Methoden weitervorantreiben und vor allem ihr therapeutisches Potenzial ausloten.
Von Katharina Kalhoff und Gesa Terstiege
Ihr Vater wünschte sich für sie eine Karriere als Rechtsanwältin, weil sie als Kind nicht aufhörte zu reden, bis ihr alle zustimmten. „Meine Mutter hatte Sorge, dass ich dann mit zu vielen korrupten Menschen oder Mafiosi zu tun habe. Mich hat allerdings hauptsächlich der Blick ins bürgerliche Gesetzbuch abgeschreckt – das war mir zu langweilig“, erklärt die Wissenschaftlerin Barbara Di Ventura von der Universität Freiburg und lacht. Statt auf Jura fiel die Studienwahl in ihrer Heimat Rom dann auf Ingenieurwissenschaften mit Schwerpunkt Informatik. Heute ist sie Professorin für biologische Signalforschung an der Universität Freiburg und möchte mit ihrer Forschung in Zukunft bessere Krebstherapien ermöglichen.
Ihr Wechsel zur Biologie begann mit einer Masterarbeit zur Modellierung von Gennetzwerken. Ursprünglich wollte die Ingenieurin gar nicht promovieren, aber sie reizte ein Auslandsaufenthalt. Das Europäische Labor für Molekularbiologie (EMBL) suchte damals Doktoranden an mehreren Standorten in Europa. „Deutschland hatte ich für meine Zukunft gar nicht auf dem Schirm, aber ich habe mich sehr schnell in Heidelberg verliebt. Das Leben ist unvorhersehbar“, kommentiert sie ihren Werdegang. Geplant war, dass sie Computermodelle entwickelt, die auf biologischen Experimenten beruhen. „Schnell hatte ich keine Lust mehr, immer auf die Daten der Experimentierenden zu warten und habe mich selbst ins Labor gestellt – ohne jegliche Vorkenntnisse. Mein damaliger Betreuer Luis Serrano hat mich zum Glück sehr unterstützt“, erinnert sich die Wissenschaftlerin.
Gute Zusammenarbeit im Team ist entscheidend
Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war der Aufbau einer eigenen Arbeitsgruppe. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat sie hierbei im Rahmen einer „e:Bio-Nachwuchsgruppe“ mit knapp 1,5 Millionen Euro unterstützt. „Die Förderung war sehr wichtig für meine weitere Karriere. Ohne die Nachwuchsgruppe hätte ich die Professur in Freiburg wahrscheinlich nicht bekommen. So konnte ich zeigen, dass ich unabhängig arbeiten und Themen vorantreiben kann“, erklärt die Wissenschaftlerin. „Wobei ich auch immer inspirierende Mentoren und Unterstützer hatte, die mich gefördert und in meinen wissenschaftlichen Visionen unterstützt haben – Wissenschaft ist Teamarbeit“. In ihrem Forschungsfeld geht es dabei vor allem um eine Zusammenarbeit von Menschen, die sich den biologischen Fragestellungen auf verschiedene Weise nähern. Ein Teil ihres Teams entwickelt sogenannte optogenetische Werkzeuge, andere modellieren die Vorgänge und wieder ein anderer Teil nutzt diese Werkzeuge, um biologische Fragen zu beantworten.
Optogenetik bezieht sich dabei, wie der Name schon verrät, auf die Kombination aus optischen Methoden und Genetik. Die Forscherinnen und Forscher nutzen Licht, um z. B. einzelne Gene an- oder auszuschalten. Licht als Trigger für molekulare Prozesse zu nutzen hat einige Vorteile. Zum einen ist die Reaktion sehr schnell und sehr einfach anzuwenden. Licht löst keine unerwünschten Wirkungen in der Zelle aus – im Gegensatz zu kleinen Molekülen, die sonst häufig für Manipulationen in der Zelle eingesetzt werden. Ihre Begeisterung für die Arbeit schwingt in jedem Satz mit, wenn die 45-Jährige über ihre Arbeit spricht. „Auf dem Gebiet der Optogenetik wäre die Entwicklung eines einkomponentigen, kleinen, einfach zu bedienenden optogenetischen Werkzeugs, das auf rotes Licht reagiert, ein echter Durchbruch. Diese Art von Licht kann tiefer in das Gewebe eindringen und könnte eines Tages mit Erfolg bei Patienten eingesetzt werden um Krebs zu behandeln.“ Als Ingenieurin, die erst spät in die Molekularbiologie eingestiegen ist, sei ihr Fachgebiet, die Synthetische Biologie, genau das Richtige für sie gewesen. „Hier kann ich mein Wissen aus beiden Bereichen perfekt kombinieren“, erzählt sie begeistert. Mittlerweile hat sie eine Arbeitsgruppe mit zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgebaut, von denen 80 Prozent experimentell und 20 Prozent an theoretischen Modellen arbeiten.
„Auch wenn es verrückt klingt: Ich genieße jeden Arbeitstag“
Privat ist die Italienerin ebenfalls seit Jahren in Deutschland angekommen und genießt das Leben in Süddeutschland mit Mann und Sohn. Die internationale Forschung ist und bleibt aber genauso wichtig für sie. Sie erfreue sich an der Freiheit und der Kreativität, die mit der Forschung verbunden seien und genieße die Interaktion mit ihrem Team und den Studierenden: „Auch wenn es verrückt klingt: Ich genieße jeden Arbeitstag“.
Nur eine Sache kann bei der lebensfrohen Italienerin für kurzzeitige Verstimmung sorgen: „Da ich selbst ein extrem engagierter und motivierter Mensch bin, frustriert es mich, wenn meine Studierenden unmotiviert sind. Mich irritiert mangelnde Hingabe.“ Wer die Wissenschaftlerin in Zeiten ohne pandemiebedingte Einschränkungen nicht an der Universität oder auf internationalen Kongressen antrifft, hat vielleicht einmal die Chance, sie über die musikalische Seite kennenzulernen. „Ich singe leidenschaftlich gern in einer Rockband. Es ist natürlich keine Voraussetzung, aber wer wissenschaftlich hochmotiviert ist und ein Instrument spielt, kann sich gerne bei uns bewerben“, verrät sie mit einem Augenzwinkern.