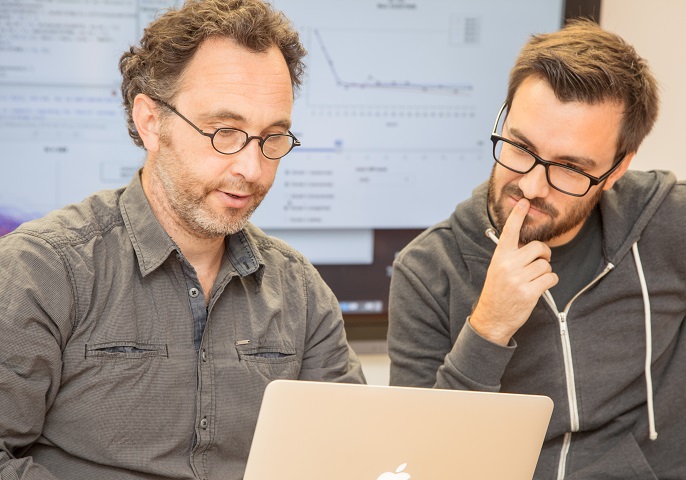Forschungsteam entwickelt Simulatoren, die den Krankheitsverlauf individuell voraussagen
Krebstherapien haben das Überleben der Erkrankten zum Ziel, doch oftmals sind sie auch mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden. Forscherinnen und Forscher aus Dresden, Leipzig und Jena haben mathematische Modelle entwickelt, mit deren Hilfe die Behandlung in Stärke und Dauer individuell auf jeden einzelnen Krebskranken abgestimmt werden kann. So könnten den Patientinnen und Patienten künftig langwierige und belastende Therapien erspart bleiben. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt das Projekt im Rahmen des Forschungs- und Förderkonzepts „e:Med“.
Von Melanie Bergs
Die Krankheit beginnt meist schleichend. Oft sind über mehrere Jahre hinweg keine Symptome zu bemerken. Die chronische myeloische Leukämie, kurz CML genannt, wird daher häufig zufällig bei einer Blutuntersuchung entdeckt. Später können Beschwerden wie Müdigkeit, Gewichtsabnahme oder Appetitlosigkeit auf die Krankheit hinweisen. Zudem ist die Milz angeschwollen. Die CML ist eine tödliche Erkrankung des blutbildenden Systems und macht etwa 20 Prozent aller Leukämie-Erkrankungen im Erwachsenenalter aus.
Anders als bei den meisten anderen Krebsarten sind die genetischen Ursachen der CML jedoch bekannt. Bei fast allen Patientinnen und Patienten wird die Krankheit durch denselben Gen-Defekt in den Stammzellen ausgelöst. Daher ist es seit einigen Jahren möglich, die Tumorzellen mit so genannten Tyrosinkinasehemmern gezielt zu bekämpfen. Diese Medikamente blockieren die Tyrosinkinase, ein spezielles Enzym, das in den Krebszellen überaktiv ist. Damit gelingt es in vielen Fällen, die Leukämie dauerhaft in Schach zu halten. Zudem bleiben gesunde Zellen von der Therapie weitgehend verschont. Chemotherapie oder gar eine Stammzelltransplantation kommen daher bei einer CML-Erkrankung eher selten zum Einsatz.
Individuelles Rückfallrisiko voraussagen
Gerade weil die CML so gut erforscht und verhältnismäßig leicht therapierbar ist, war sie für Professor Ingo Röder von der TU Dresden als Forschungsobjekt besonders interessant. Der Mathematiker und sein Team haben Computermodelle entwickelt, die vorhersagen sollen, ob eine Krebstherapie anschlägt oder nicht. „Bei der CML können wir schon sehr gut zeigen, dass mathematische Modelle prinzipiell in der Lage sind, Krebstherapien zu optimieren“, sagt Röder.
Ziel der Forscherinnen und Forscher ist es, das individuelle Rückfallrisiko der Erkrankten nach Absetzen der Therapie vorauszusagen. Denn obwohl sich die CML weitgehend zu einer beherrschbaren Krebserkrankung entwickelt hat, ist die Behandlung mit Nebenwirkungen verbunden. Insbesondere über die Auswirkungen einer dauerhaften Therapie auf junge Patientinnen und Patienten ist noch wenig bekannt. „Derzeit ist bei CML eine lebenslange Therapie üblich“, erklärt Röder. „Einige Mediziner setzen die Behandlung innerhalb klinischer Studien versuchsweise nach einer zweijährigen Remissionsphase ab.“ Dieser Zeitpunkt ist aus Röders Sicht jedoch zu willkürlich gewählt. „Bei zu frühem Absetzten besteht mit dem Rückfallrisiko auch die Gefahr, dass der Tumor mutiert und dann unter Umständen nicht mehr auf die übliche Therapie anspricht.“
Chemotherapien patientenspezifisch optimieren
Für Ärztinnen und Ärzte ist es bislang jedoch schwer einzuschätzen, welchen Verlauf die Krankheit bei einem bestimmten Patienten nehmen könnte. Denn die Tumorzellen sind im Blut oftmals jahrelang nicht nachweisbar. „Die leukämischen Stammzellen sitzen im Knochenmark“, erklärt Röder. „Doch eine genaue Quantifizierung der verbleibenden Tumorstammzellen durch eine Knochenmark-Biopsie ist kaum möglich.“ Genau hier setzt das Computermodell des Dresdner Forschungsteams an. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben es mit den Krankheitsverläufen und Daten von hunderten CML-Patientinnen und -Patienten gespeist. Auf dieser Grundlage kann das Modell nun für jeden einzelnen Krebskranken eine mathematisch-basierte Vorhersage zur Entwicklung der Tumorzellen im Knochenmark und damit zum wahrscheinlichen Krankheitsverlauf treffen. Anhand dieser Abschätzung können nun Aussagen über das Rückfallrisiko eines Patienten getroffen werden und damit auch darüber, wann und ob das Absetzen der Therapie ratsam ist.
Forscherkolleginnen und -kollegen an der Universität Leipzig haben im selben Projekt weitere Modelle entwickelt, die geeignet sind, Chemotherapien patientenspezifisch zu optimieren. Der große Nachteil dieser Therapieform: Sie greift nicht nur den Krebs an sondern auch gesunde Körperzellen. „Gerade Immunzellen sind durch die Chemotherapie stark betroffen. Dadurch sind die Patienten extrem anfällig für Infektionen“, so Röder. Das Ziel der Leipziger ist es daher, die Reduktion der Immunzellen durch die Chemotherapie so weit wie möglich abzuschwächen. Ihre Computermodelle können bei verschiedenen Krebsarten den Effekt der Behandlung auf das Blutsystem des Erkrankten vorhersagen. So sollen Ärztinnen und Ärzte künftig in die Lage versetzt werden, das optimale Gleichgewicht zwischen Stärke der Chemotherapie und effektiver Tumorbekämpfung für jeden einzelnen Patienten zu bestimmen.
Das Bundesforschungsministerium unterstützt das interdisziplinäre Forschungsteam aus Mathematikern, Statistikern, Bioinformatikern, Ärzten und Biologen noch bis 2018. Derzeit überprüfen die Forscherinnen und Forscher die Aussagekraft ihrer Modelle mit Hilfe von Patientendaten aus internationalen Studien. Die ersten Ergebnisse deuten laut Röder bereits darauf hin, dass ihre Vorhersagen treffsicher sind. Wenn alles nach Plan läuft, könnten die Computermodelle in ein paar Jahren zertifiziert und damit bereit sein für den Einsatz im Klinikalltag.
Dieser Beitrag ist im Newsletter des Bundesforschungsministeriums "Aktuelle Ergebnisse der Gesundheitsforschung" erschienen (Ausgabe 80/2016).